![]() Originalhörspiel
Originalhörspiel
Autor/Autorin:
Patrick Findeis
Metamorphosen
Aus dem Leben der Maria Sibylla Merian
Maria Sibylla Merian zum 300. Todestag
Komposition: Tarwater
Dramaturgie: Andrea Oetzmann
Technische Realisierung: Daniel Senger, Andreas Völzing, Sonja Röder
Regieassistenz: Constanze Renner
Regie: Kai Grehn
Weitere Mitwirkende
Sprecher/Sprecherin Rolle/Funktion Anne Ratte-Polle Maria Sybilla Merian Lilith Stangenberg Dorothea Merian Virginia Mukwesha Alice
Moskitos, Motten, Nachtfalter umkreisen die Öllampe in
einem Holzhaus am Rande von Paramaribo, der Hauptstadt
Surinams. Es ist April, Regenzeit, im Jahr 1701.
Kakerlaken huschen in dunklen Ecken, in die das schwache
Licht der Lampe nicht hinreicht, schwüle Hitze und
der Geruch von Krankheit füllen den Raum. Maria Sibylla
Merian hat Malaria, Gelbfieber, irgendeine der zahllosen
Tropenkrankheiten, im Fieberwahn fantasiert sie ihr vergangenes
Leben: Hineingeboren in die Zerstörung, die der Dreißigjährige
Krieg in weiten Teilen des Deutschen Reichs hinterließ, in
Pestjahre, Hungerjahre, Kältejahre, ist ihr Leben immerhin
privilegiert: Ihr Vater ist der bekannte Kupferstecher
und Verleger Matthäus Merian, ein alter Mann bei
ihrer Geburt, der stirbt, als Maria Sibylla drei Jahre alt
ist. Bereits ein Jahr später heiratet die streng pietistische
Mutter den Blumenmaler Jacob Marrel. Er lehrt das Mädchen
das Malen von Stillleben und das Kupferstechen zu
einer Zeit, in der Frauen der Zugang zu Kunstakademien
und Werkstätten nicht gewährt wird. Mit dreizehn Jahren
entdeckt Merian ihre Passion für Raupen und deren
Metamorphose zum Sommervogel, dem Schmetterling.
Ihre Holzkisten mit gesammelten Raupen und deren
Wirtspflanzen, mit Puppen und Kokons, werden Merian
bis zu ihrem Tod 1717 begleiten – von ihrer Geburtsstadt
Frankfurt aus nach Nürnberg, nach Schloss Walta-State
in Friesland, wo die pietistische Sekte der Labadisten ein
Neu-Jerusalem errichtet zu haben glaubt, nach Amsterdam.
Und schließlich nach Surinam, wohin sie 1700 aufbricht
um zu forschen, zu zeichnen, zu malen.
Das Hörspiel folgt Merians Liebe zur Natur, ihrer Weltsicht
als Künstlerin und Mystikerin, die im kleinen, unscheinbaren Dasein der Insekten die Größe von Gottes Schöpfung sichtbar zu machen versuchte. Die Metamorphose
spielt nicht nur in Merians Werk eine große Rolle,
auch ihr Leben unterlag mehreren Wandlungen. Sie war
Ehefrau und Mutter, ernährte ihre Familie, veröffentlichte
Blumen- und Raupenbücher, stellte Farben her und
handelte mit ihnen, gab höheren Töchtern Unterricht im
Zeichnen und Malen. Dann, nach fünfzehn Jahren Ehe,
verließ sie ihren Mann in Nürnberg und blieb bei der
pietistischen Sekte der Labadisten. Und nach fünf Jahren
Klosterleben wieder eine Häutung: Sie verließ die Sekte
und betrat die Amsterdamer Gesellschaft als geschiedene
und selbstbewusste Frau und Künstlerin, die gegen
alle Widerstände ihre Reise nach Surinam vorbereitete
und durchführte. Das Ergebnis dieser Reise, ihr Buch
"Metamorphosis insectorum Surinamensium" hatte
großen Einfluss auf Wissenschaft und Kunst und machte
Merian berühmt. Die Künstlerin starb am 13.01.1717 im
Alter von 69 Jahren in Amsterdam. Man beerdigte sie in
einem Armengrab, das heute nicht mehr aufzufinden ist.
Weitere Informationen
Patrick Findeis, geboren 1975 in Heidenheim an der
Brenz, lebt als freier Autor in Berlin. Er studierte Komparatistik, Psychologie
und Kommunikationsforschung an der Universitat Bonn und ist Absolvent des
Deutschen Literaturinstituts Leipzig. Für seinen Debütroman »Kein schöner
Land« erhielt Findeis 2008 den 3sat-Preis
im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs. Er ist Autor der
Hörspiele "Kein schöner Land" (SWR 2012) "Schneewalzer" (SWR
2013), "Hannelore. Oder: So ein abgelichtetes Leben will verkraftet
sein" (SWR 2014), "Wölfe, Wölfe!" (SWR 2015).
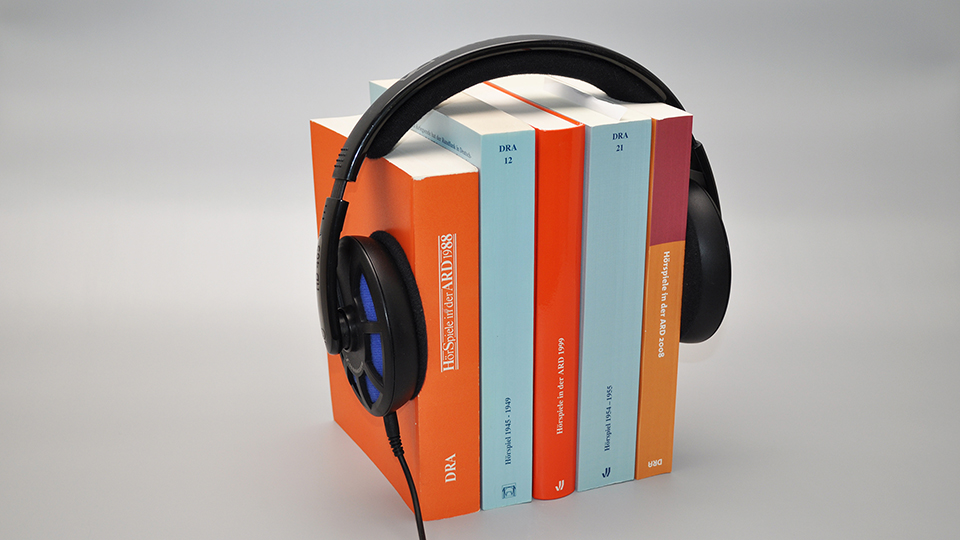
Produktions- und Sendedaten
- Südwestrundfunk 2016
- Erstsendung: 08.01.2017 | SWR2 | 74'11
Rezensionen (Auswahl)
- Stefan Fischer: Insekt im Ohr. In: Süddeutsche Zeitung vom 4.1.2017.
- Eva-Maria Lenz: Lebens- und Forscherfreude. In: epd medien, Nr. 3 vom 20.1.2017, S. 36.
- Christian Hörburger: Filigran und schwebend. In: Medienkorrespondenz, Nr. 2-3 vom 27.1.2017, S. 54.

