![]() Originalhörspiel
Originalhörspiel
Autor/Autorin:
Georges Perec
Konzertstück
Komposition: Philippe Drogoz
Künstlerische Aufnahmeleitung: Günter Braun
Technische Realisierung: Yves Rudelles, Ernst Becker, Erich Heigold, Rosel Wack
Regieassistenz: Gerd Arend, Wolf Quiel
Weitere Mitwirkende
Sprecher/Sprecherin Rolle/Funktion Peer Schmidt Richard (?) Peter Schmitz Conferencier Robert Seibert Freund Ernst Alisch Wirt Erich Herr Taxifahrer Heinz Menzel Logenschließer Rolf Arndt Ein-Mann-Orchester Lothar Rollauer Johann Marianne Lochert Seine Frau Götz Rogge Beider Sohn Charles Wirths Ludwig Renate Böhnisch Brunhilde Alice Hoffmann Mädchen Martha Nicodemus Mädchen Hannelore Schönfeld Mädchen Annegreth Ronald Mädchen Gerlinde Liptow-Dillge Mädchen Ingrid Braun Mädchen Agnes Hofmüller Mädchen Monika Reim Mädchen Carla Best Freundin Richards Brigitte Dryander Freundin Richards Antje Roosch Freundin Richards Yvonne Krauss Freundin Richards Otto-Karl Müller Freund Richards Engelbert von Nordhausen Freund Richards Karin Schröder Filmdiva Dieter Eppler Filmheld Arnold Richter Übersetzer Friedrich Otto Scholz Stimme aus dem Salzburger Bahnhofslautsprecher Günter Stutz Wolfgang Schenck Willkit Greuèl Oberkellner Imre Molnar Kapellmeister Knesch Professor Sonstige Mitwirkende Funktion N. N. Studenten der Universität des Saarlandes und der Schauspielschule Philippe Drogoz Schreibmaschine Musik: Gesine Ehrbrecht (Violine)
Orchester: Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken, Rundfunk-Kammerorchester Saarbrücken, Tanzorchester des Saarländischen Rundfunks
Musikalische Leitung: Horst Henke
Verteilt auf 17 autonome Stationen erfährt einer, der sich aufmacht, die Musik im Alltag zu erforschen, dass seine klassisch-erhabenen Vorstellungen von Musik, von Brahms, Weber, Bach, nicht in Einklang zu bringen sind mit der weniger erhabenen Wirklichkeit, mit Taxis, Zirkus, Kino, Musikbox. Aber diese Stationen bzw. Episoden, die auf Grund des Missverhältnisses von schöner Illusion und Wirklichkeit immer komisch-katastrophal enden, bestimmen nicht allein und nicht einmal entscheidend die Wirksamkeit des Stückes. Entscheidend ist das formale Verhältnis von Sprache und Musik, das streng nach musikalischen Gesetzmäßigkeiten strukturiert ist. Wenn unter der Spezies "Form der Musik" Titel erscheinen wie "Echoquartett", "Kanon für Maultrommeln", "Sonate für Schreibmaschine" usw., so finden diese Strukturen 'Kanon', 'Sonate' ihre exakte sprachliche Entsprechung an anderer Stelle des Stückes. Es handelt sich also um eine Art versetztes Spiegelbild von Sprache und Musik und umgekehrt. Dieses Versetzen, die Widerspiegelung, die Tatsache, daß die der musikalischen angeglichene sprachliche Struktur an anderer Stelle - eine andere Episode - einen neuen Inhalt vermittelt, daß außerdem vom Komponisten Philippe Drogoz ausschließlich die Sonaten und Partiten für Violine von J. S. Bach (BBV 1001-1007) als variierende Grundmuster benutzt wurden, schafft ein Spannungsverhältnis von Musik, Sprache, akustischer Aktion und Clownerie. Insofern ist das Hörspiel "Konzertstück" in allererster Linie als Unterhaltungshörspiel zu verstehen, das spielerisch und parodistisch mit längst Bekanntem umgeht.
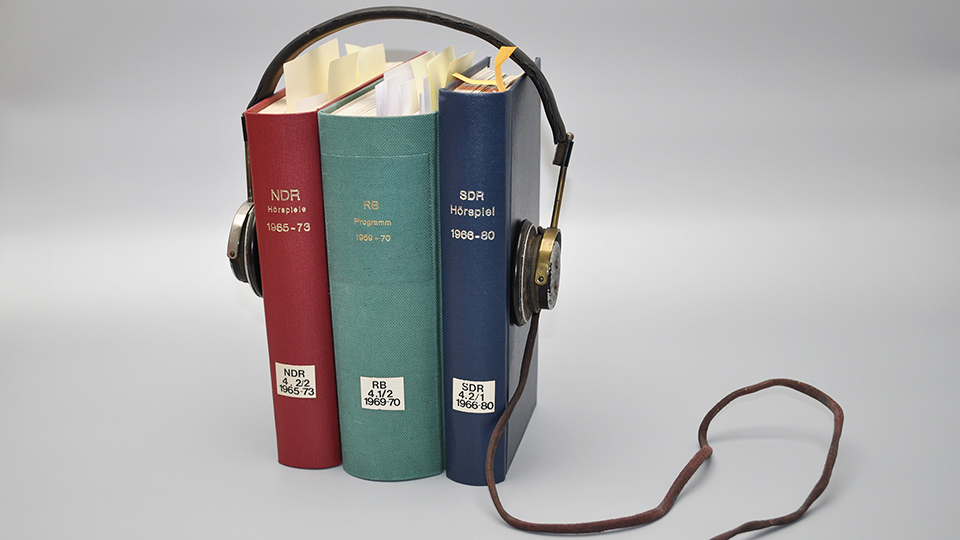
Produktions- und Sendedaten
- Saarländischer Rundfunk / Hessischer Rundfunk 1974
- Erstsendung: 18.07.1974 | 65'04

